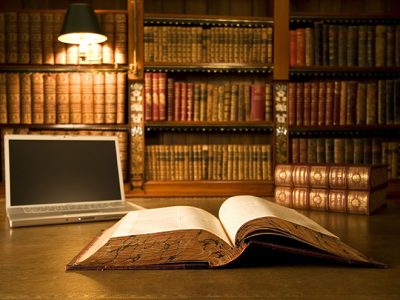Was sind Leistungsschutzrechte?
Das deutsche Urheberrechtsgesetz (UrhG) schützt nicht nur ganz klassisch Urheber und ihre „Werke“. In seinem 2. Teil kennt das UrhG auch so genannte „Leistungsschutzrechte“. Aber was sind Leistungsschutzrechte und was wird dadurch geschützt?